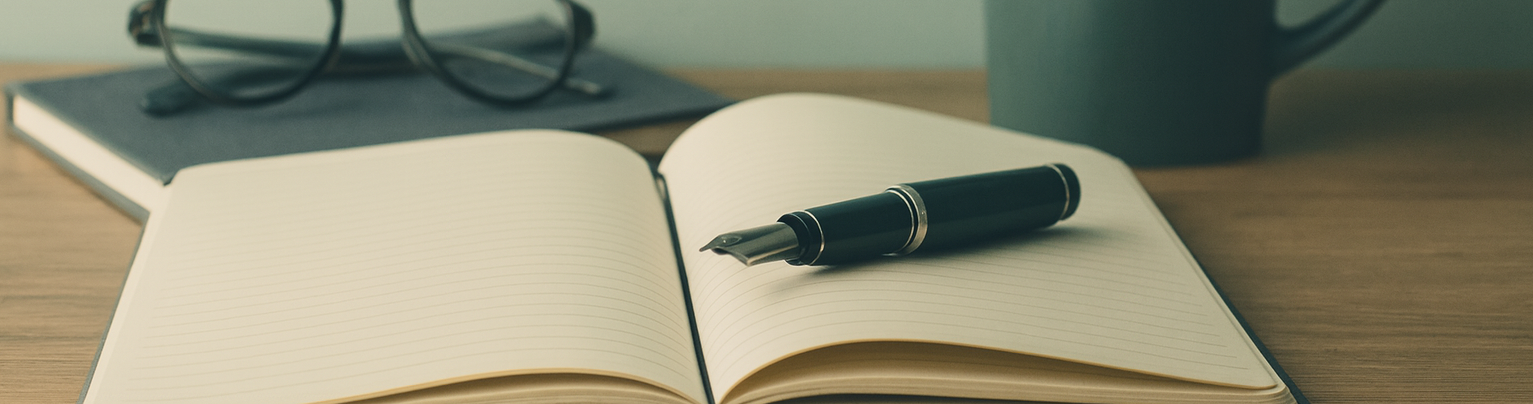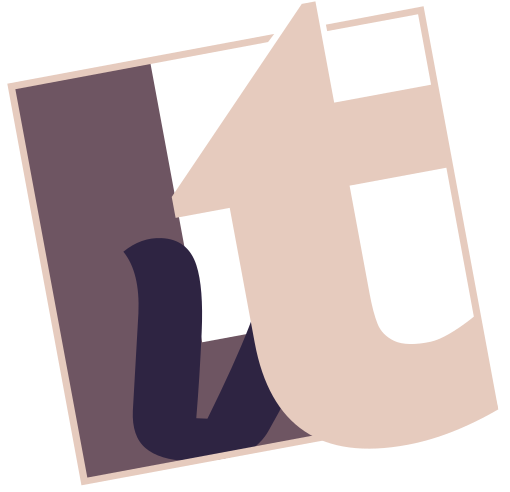Adipositas – (M)eine chronische Krankheit, die keiner bezahlen will
Wenn ich ehrlich bin, habe ich jahrelang gedacht, mein Problem sei einfach zu viel Essen und zu wenig Bewegung. So sagen es ja alle: „Iss halt weniger, dann nimmst du auch ab.“
Klingt logisch, ist aber, wie ich jetzt weiß, falsch. Zumindest greift dieser Gedanke deutlich zu kurz.
Zwar haben verschiedene Ärzte Sätze zu mir gesagt wie: „Sie leiden an Adipositas.“ oder „Sie sind adipös.“, aber nie hat mir jemand erklärt was das genau bedeutet. Ich dachte das ist der medizinische Ausdruck für fett. Um genau zu sein dachte ich das bis zum Sommer 2025. Als ich meine Nachforschungen zu den „Abnehmspritzen“ und allem drumherum angestellt habe, erfuhr ich zum ersten Mal, dass hier von einer chronischen Krankheit die Rede ist.
Chronische Krankheit? Sie wie Rheuma oder Diabetes? Ja. Genau. Aber der Reihe nach:
Was ist Adipositas?
Adipositas, umgangssprachlich Fettleibigkeit genannt, bezeichnet eine über das normale Maß hinausgehende Ansammlung von Körperfett. Medizinisch wird sie in der Regel anhand des Body-Mass-Index (BMI) definiert. Ab einem BMI von 30 kg/m² spricht man von Adipositas. (Quelle: Wikipedia)
So, bis hierhin stimmte ja meine damalige Annahme noch, dass es einfach ein anderer Ausdruck für „zu fett“ ist. Aber das ist leider nicht alles. Im Körper passieren viele weitere Dinge:
Hormone wie Leptin, Ghrelin und Insulin geraten aus dem Gleichgewicht, das Sättigungsgefühl funktioniert nicht mehr wie bei Gesunden. Der Stoffwechsel wird auf Gewichtserhalt programmiert – selbst wenn man weniger isst. Das erklärt im Übrigen auch, warum die meisten Diätversuche langfristig scheitern.
Des weiteren spielt auch das Hormon GLP-1 eine wichtige Rolle. Du hast vielleicht schonmal im Zusammenhang mit den so genannten „Abnehmspritzen“ davon gehört. Weitergehende Informationen dazu findest Du in dem Beitrag Die Abnhemspritze
Welche Folgen hat Adipositas für den Organismus?
Adipositas betrifft nahezu jedes Organsystem. Zu den häufigsten Folgeerkrankungen gehören:
- Kardiovaskuläre Erkrankungen: Bluthochdruck, koronare Herzkrankheit, Herzinfarkt
- Stoffwechselstörungen: Typ-2-Diabetes, Fettstoffwechselstörungen
- Orthopädische Probleme: Gelenkverschleiß, Rückenschmerzen
- Hormonelle Störungen: Polyzystisches Ovarialsyndrom (PCOS), Fertilitätsprobleme
- Krebsrisiko: Erhöhtes Risiko u. a. für Brust-, Darm- und Leberkrebs
- Psychische Belastung: Depression, Essstörungen, soziale Stigmatisierung
Diese Begleiterkrankungen führen zu einer deutlich erhöhten Mortalität und Morbidität, also einer höheren Sterblichkeit und Krankheitslast.
Wenn man jetzt noch bedenkt, dass ca. ein Viertel der Erwachsenen in Deutschland adipös sind (Quelle: Robert-Koch-Institut (RKI)), wird schnell klar, dass es hier neben den persönlichen Schicksalen, auch um ein gewaltiges Problem für das öffentliche Gesundheitssystem geht. Die Folgeerkrankungen sind nämlich in der Regel deutlich teurer, als eine frühzeitige Behandlung der Adipositas. Aber dazu kommen wir noch…
Warum zählt Adipositas zu den chronischen Erkrankungen?
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO), die Deutsche Adipositas-Gesellschaft (DAG) und die American Medical Association (AMA) stufen Adipositas als chronische Krankheit ein. Auch die IDC-10 (Internationale Klassifikation der Krankheiten) führt sie unter dem Code E66 als eigenständige Krankheit.
Chronisch ist sie weil:
- Dauerhaft besteht: Adipositas entwickelt sich über Jahre und bleibt meist lebenslang bestehen.
- Rückfallrisiko hoch ist: Selbst nach erfolgreicher Gewichtsreduktion kommt es häufig zu erneuter Gewichtszunahme, da der Körper durch hormonelle Anpassungen den Energieverbrauch senkt und Hungerhormone wie Ghrelin erhöht.
- Multifaktoriell verursacht: Genetik, Stoffwechsel, Mikrobiom, Schlafmangel, Stress, Medikamente und die moderne Lebensweise wirken zusammen.
- Behandlungsbedarf lebenslang bleibt: Ohne kontinuierliche medizinische und verhaltensorientierte Betreuung verschlechtert sich die Erkrankung.
Die Situation in Deutschland
Wir können also festhalten: Adipositas wird international und auch in Deutschland als chronische Krankheit eingestuft und anerkannt. Punkt. Sonst nichts.
Weitere Konsequenzen werden bislang daraus nicht gezogen. Keinerlei Erstattung oder Unterstützung bei den den Behandlungskosten zum Beispiel.
Ärztinnen und Ärzte können Adipositas diagnostizieren, dokumentieren und behandeln. Aber in der Praxis wird sie noch nicht wie andere chronische Erkrankungen (z. B. Diabetes oder Bluthochdruck) behandelt – insbesondere, wenn es um die Kostenerstattung geht.
Das ist extrem frustrierend für Betroffene wie mich – um nicht zu sagen ein Schlag ins Gesicht. Es ist so als würden auch die Krankenkassen zu einem sagen: „Selbst schuld! Guck wie du klar kommst!“ oder „Du willst abnehmen? Dann reiß dich halt zusammen!“ oder „Du willst schlanker sein? Das ist ein Lifestyle-Problem und dafür sind wir nicht zuständig!“.
Es liegt hier also eine völlige Ungleichbehandlung vor. Eine chronische Krankheit ist eine chronische Krankheit. Oder gibt es da schlimme und weniger schlimme?
Was ist wenn der Kostendruck weiter steigt – und das wird er? Sagen sie dann zu einem Diabetiker: „Reiß dich halt zusammen, dann brauchste kein Insulin?“
Ich will keine falschen Vergleiche ziehen, aber ich denke es ist klar was ich meine, oder?!
Aber ehrlich gesagt passt das sehr gut in den Gesamteindruck, den ich von unserem (grundsätzlich guten) Gesundheitssystem habe: gezahlt wird erst dann, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist.
Wenn Adipositas unbehandelt bleibt (was leider bei den meisten der Fall ist), treten häufig Folgeerkrankungen auf. Bei denen werden dann die Kosten erstattet. Ich bin das beste Beispiel dafür: meine Blutdruckmedikamente und mein CPAP-Gerät incl. Zubehör (zur Therapie der Schlafapnoe) werden bezahlt, eine Therapie die verhindert das solche Erkrankungen überhaupt erst auftreten, wird nicht bezahlt. Da reden wir jetzt noch von relativ kleinen Beträgen. Erleidet ein adipöser Mensch erstmal einen Herzinfarkt oder Schlaganfall wird es richtig teuer für die Krankenkasse (und damit für (fast) uns alle).
Die selbe Erfahrung habe ich übrigens bei meinem Kampf mit der Techniker Krankenkasse gemacht. Schlaflabor bezahlen sie nicht, erst wenn man einen Herzinfarkt etc. hatte. Mein Argument, dass ich mit der Therapie gegen meine Schlafapnoe (wozu eine Untersuchung im Schlaflabor erforderlich ist) ja eben genau solche Sachen (Schlaganfall usw.), verhindern will, wurde nicht gehört. Mehr dazu hier.
Ich sage Dir: das frustriert mich nicht nur, das macht mich echt wütend!
Glücklicherweise bin ich der Lage meine Therapien selbst zu bezahlen. Allerdings bedeutet das auch für mich eine große finanzielle Anstrengung und leider können sich das sehr, sehr viele Menschen nicht leisten.
Immerhin befasst sich anscheinend der G-BA*) (gemeinsamer Bundesausschuss) zur Zeit mit diesem Thema und man darf hoffen, dass dieser Missstand schnell behoben wird.
*) Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) ist das oberste Gremium der Selbstverwaltung im deutschen Gesundheitswesen und hat die Aufgabe, rechtsverbindlich zu entscheiden, welche medizinischen Leistungen von der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) bezahlt werden.
Cheers!